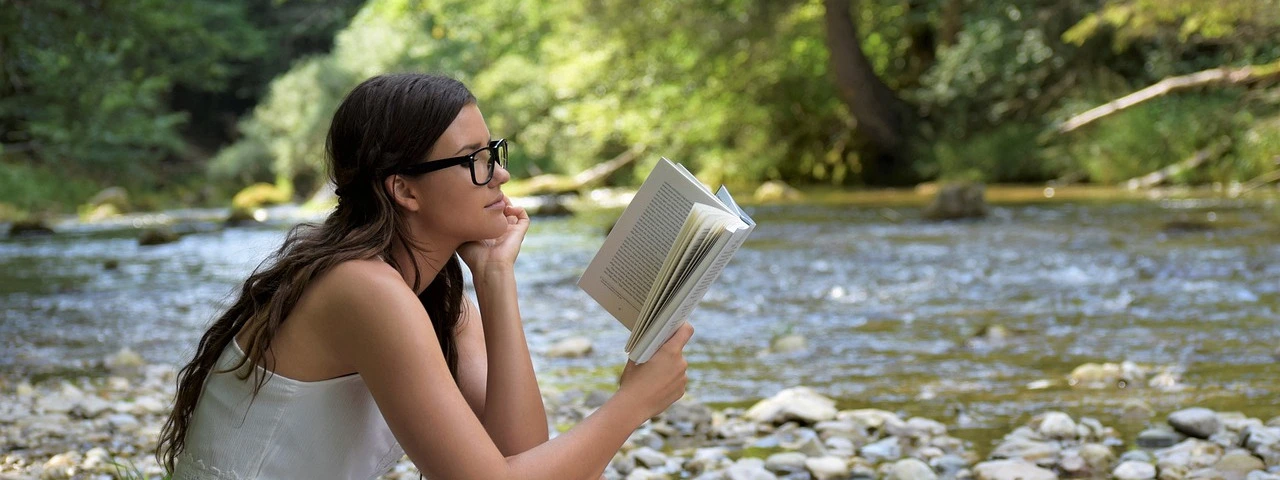
Warum Denken schützt und was Philosophie mit Umweltschutz zu tun hat
„Das Denken schützt vor der Tyrannei der Meinung.“
– Hannah Arendt
Wir sitzen vor dem Fernseher. Irgendwo redet ein Politiker in einem Talkshowstudio über die Abholzung im Regenwald. Kurz darauf beim Abendessen sagt unser Onkel: „Ich bin ja auch für Umweltschutz, aber…“ Am nächsten Tag gehen wir durch die Stadt und laufen direkt in eine Straßenblockade von Klimaaktivist*innen. Menschen sitzen auf der Straße. Andere schreien.
Und wir mittendrin.
Drei Stimmen. Drei Meinungen. Drei Haltungen.
Aber was die meisten nicht sehen: Hinter jeder einzelnen steckt eine Ethik.
Die Meinung des Politikers.
Der Kommentar vom Onkel.
Der Protest auf der Straße.
Alle beruhen auf einem moralischen Fundament – auf einer Idee davon, was richtig ist, was zählt, was gerecht ist.
Nur: Die wenigsten Menschen wissen, welches Fundament sie eigentlich benutzen.
Sie sprechen von Werten, aber können sie nicht benennen.
Sie handeln aus Überzeugung, aber wissen nicht, woher sie kommt.
Sie denken – aber hinterfragen nicht.
Sie glauben – aber sie prüfen nicht, woran.
Wir alle haben Meinungen, aber nur die wenigsten wissen, woher sie kommen.
Warum wir denken, was wir denken, welche Werte dahinterstecken und ob das woran wir glauben, überhaupt zu dem passt, wer wir eigentlich sind. Genau hier setzt diese Artikelreihe an.
Wir wollen gemeinsam einen Schritt tiefer gehen und hinter die verschiedenen Meinungen schauen.
Wir erkunden zusammen philosophische Denkmodelle und arbeiten sie einfach, verständlich und greifbar auf. Damit wir herausfinden können:
- Welche ethischen Konzepte gibt es überhaupt?
- Was meinen wir wirklich, wenn wir sagen: „Die Umwelt ist wichtig“?
- Wieviel Wert steckt hinter solchen Sätzen und welches Menschenbild schwingt dabei mit?
- Welche dieser philosophischen Sichtweisen passen zu unserem eigenen Denken/Wertekomplex und welche lehnen wir vielleicht ganz bewusst oder auch unbewusst ab?
Denn nur wer versteht, wie er denkt,
kann wirklich sagen, wofür er steht.
Wie es weitergeht
Doch bevor wir gemeinsam in die großen ethischen Theorien wie Utilitarismus, Deontologie oder Tugendethik einsteigen, machen wir noch einen Schritt zurück.
Denn um überhaupt zu verstehen, wie wir urteilen, was wir mit Begriffen wie „gut“, „richtig“ oder „gerecht“ meinen, müssen wir erstmal klären, was Philosophie eigentlich leisten kann und was sie nicht ist. Was meint es überhaupt, wenn jemand sagt: „Das ist moralisch falsch“? Gibt es so etwas wie moralische Tatsachen? Und wenn ja – woher wissen wir das?
In dem nächsten Abschnitt dieser Artikelreihe wird es deshalb erstmal etwas theoretischer. Nicht trocken, keine Angst – aber es wird grundlegender. Denn wer über Umwelt spricht, spricht fast immer auch über Verantwortung, Gerechtigkeit und Werte – ob gewollt oder nicht. Deswegen schauen wir gemeinsam auf die Begriffe, Denkweisen und Strukturen, die hinter jeder Ethik stecken: Was ist Ethik überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen normativer Ethik, angewandter Ethik und Metaethik? Und: Warum lohnt es sich, diese Begriffe einmal sauber auseinanderzuhalten, bevor wir uns den verschiedenen Theorien zuwenden?
Wir bauen uns gemeinsam ein philosophisches Fundament – auf das ich in allen weiteren Texten immer wieder zurückkommen werde. So schaffen wir zusammen Klarheit – auch im Denken.
Und dann geht’s los:
Wir beschäftigen uns mit den drei großen ethischen Strömungen: Utilitarismus, Deontologie und Tugendethik jeweils im Zusammenhang mit Umweltthemen. Und wir schauen uns auch die Unterströmungen und Weiterentwicklungen an, die diese Theorien besonders spannend machen – etwa den Präferenzutilitarismus, Kantische Würde-Konzepte oder moderne Tugendethik von Martha Nussbaum oder Rosalind Hursthous damit wir bei jeder zukünftigen Party unsere Mitmenschen mit unseren philosophischen Gedanken beeindrucken können.
Ich nehme dich sehr gerne mit auf diese Reise. Wenn du Fragen hast, etwas nicht verstehst, etwas kritisieren oder teilen willst: Schreib mir oder kommentiere. Denn meine Artikel sind nicht nur dazu da, gelesen zu werden, sondern gedacht und diskutiert zu werden :)
