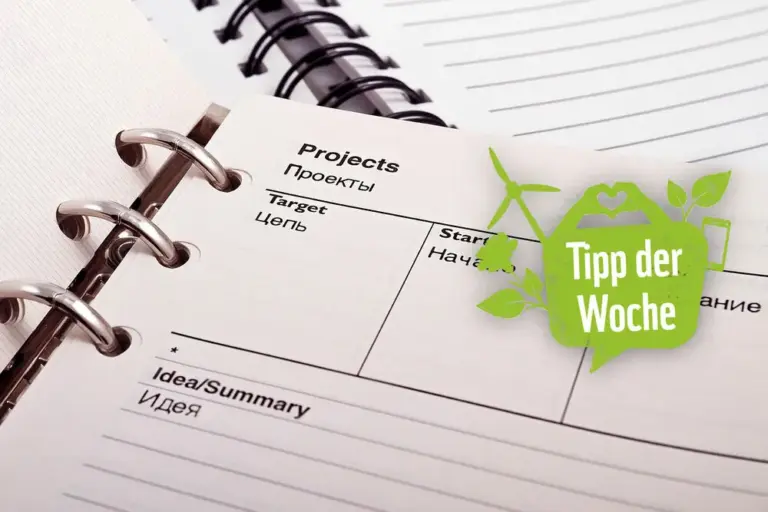Durch den Klimawandel schmelzen die Gletscher weltweit. Das hat Folgen für die Regionen, die im Einzugsgebiet des Gletschers liegen. Am Beispiel der Gletscher im Himalaya erfährst du in dieser Story, welche Auswirkungen das auf Ökosysteme und Menschen hat.

Himalaya – über den Dächern der Welt
Bestimmt hast du schon einmal die Aussage gehört „Die Regenwälder sind die Lunge des Planeten“. Über die Hochebene und die Gletscher im Himalaya könnte man sagen, sie sind das Wasserwerk der Erde.
Der Himalaya ist das höchste Gebirge der Welt und erstreckt sich über eine Länge von rund 2.500 km. Die Breite variiert, beträgt an vielen Stellen jedoch ungefähr 150 km und an der breitesten Stelle etwa 330 km. Alle Berge über 8.000 Meter befinden sich dort (also die höchsten Berge der Welt), und auch viele Siebentausender liegen im Himalaya. Dieses gewaltige Gebirge trennt Südasien vom restlichen asiatischen Kontinent und spielt eine wichtige Rolle im Klimageschehen in Asien.
Rund 4.000 Gletscher in acht Ländern liegen im Himalaya. Diese zählen zu den größten der Erde. Der Siachen-Gletscher erreicht z.B. eine Länge von 74 km. Im Winter speichern die zahlreichen Gletscher Wasser, das sie im Sommer als Schmelzwasser wieder abgeben.
Durch die große Anzahl an Gletschern und dem Eis, das sich dort befindet, nennen Klimaforscher den Himalaya manchmal auch den „dritten Pol der Erde“. Und genauso, wie das Eis in Arktis und Antarktis schwindet, schmelzen auch die Gletscher im Himalaya. Der Himalaya ist von der globalen Erwärmung besonders betroffen. Das Klima ändert sich schnell, so dass die Gletscher in den letzten 50 Jahren bereits um etwa 18% geschrumpft sind. In einigen Regionen ist der Wert sogar noch höher – teilweise sind bereits 40% der Gletschermassen verschwunden. Jedes Jahr gehen mindestens 200 km2 bzw. rund 7,7 Milliarden Tonnen Eis verloren. Laut chinesischen Wissenschaftler:innen könnte bis 2050 ein Drittel der Gletschermasse verschwunden sind, bis 2100 sogar zwei Drittel.

Luftverschmutzung in den Metropolen Asiens beschleunigt das Abschmelzen der Gletscher / © alexeva8, pixabay.com
„Schwarzer Schnee“
Hast du schon einmal von „schwarzem Schnee“ gehört? Das ist ein Phänomen, das unter anderem im Himalaya auftritt. Es meint, dass die eigentlich weiße Gletscheroberfläche durch Feinstaub schwarz verfärbt ist. Im Himalaya trifft das auf große Flächen der Eis- und Schneedecke zu. Dieses Phänomen kann zwar in Teilen weltweit beobachtet werden, im Himalaya ist es aber besonders ausgeprägt. Das liegt an den vielen riesigen Metropolen in China und Indien, die unglaubliche Mengen Feinstaub emittieren – der sich dann in den Hochgebirgen ablagert.
Der Knackpunkt ist: Dieser „schwarze Schnee“ beschleunigt das Abschmelzen der Gletscher zusätzlich. Denn während eine helle Oberfläche einen Großteil des einfallenden Sonnenlichts reflektiert und die Oberfläche dadurch kühl bleibt, nimmt eine dunkle Oberfläche einen Großteil der Wärmestrahlung auf. Das heißt, Eis und Schnee erwärmen sich und beginnen zu schmelzen.
Die Luftverschmutzung in den großen Städten Asiens beschleunigt also das Abschmelzen der Gletscher im Himalaya.

Folgen für Mensch und Natur
Wenn Gletscher schmelzen, hat dies natürlich Auswirkungen auf die Region und oft weit darüber hinaus.
Im Hochland von Tibet entspringen die 6 wichtigsten Flüsse Asiens, die rund 1,3 Milliarden (manche sprechen sogar von fast 2 Milliarden) Menschen mit Wasser versorgen. Das sind z.B. der Indus, Irrawaddy, Jangtsekiang, Saluen, der Mekong, Yangtse oder der Gelbe Fluss. Sie fließen weiter durch Pakistan, Indien, Bangladesch, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha und durch China. Ein riesiges Gebiet mit vielen Menschen. Scheitert globaler Klimaschutz, hätte dies dramatische Folgen für diese Menschen.

Selbst wenn die Menschen tausende Kilometer vom Ursprung und den Gletschern entfernt leben, sind sie von den Auswirkungen betroffen. Bisher sorgen die Gletscher für einen vorhersehbaren Wasserstand der Flüsse. Im Frühling wird durch die Gletscherschmelze mehr Wasser transportiert, was praktisch ist, wenn sich der Monsun im Frühling verzögert.
Doch durch die Gletscherschmelze führen die Flüsse erst einmal mehr Wasser. Es kommt zu Überschwemmungen. Mittelfristig geht die Pufferfunktion verloren, es gibt weniger Wasser in den Flüssen, flussabwärts drohen Dürren und Ernteausfälle. Besonders brisant ist, dass sich die Niederschlagsmuster durch den Klimawandel ebenfalls verschieben werden, was die Situation verschärft. Bereits jetzt regnet es im Norden Chinas wenig, Peking gilt sogar als „trockenste Hauptstadt der Welt“.
All das führt zu gravierenden Umweltveränderungen in der Region.
Doch die Wasserversorgung durch die Flüsse, die im Himalaya entspringen, ist nicht nur durch den Klimawandel bedroht. Die Menschen greifen ebenfalls immer stärker in den Wasserhaushalt ein. An nahezu allen großen Flüssen wurden bereits große Staudämme gebaut oder sind in Planung. Das Wasser soll Elektrizität liefern. Leider verändert das die Verteilung des Wassers langfristig. Denn die Dämme werden die Extreme voraussichtlich verschärfen, befürchten Wissenschaftler:innen. Die Stauseen halten große Mengen Wasser zurück, das in Trockenzeiten an weiter unten gelegenen Stellen fehlt. Und in der Regenzeit würden Flüsse vermutlich zu viel Wasser führen, was zu großen Überschwemmungen führen bzw. diese verstärken kann. Gleichzeitig werden durch die Staudämme Sedimente zurückgehalten, fruchtbarer Schlamm, der für die Landwirtschaft entlang der Flüsse eine zentrale Rolle spielt.
Nicht nur das: Durch die Staudämme werden auch die Fischbestände, die Artenvielfalt am und im Fluss und die angrenzenden Lebensräume in Mitleidenschaft gezogen. Baut man nun Staudämme, sinkt die Produktivität von Ökosystemen.
Und auch geopolitisch könnte der Bau von weiteren Staudämmen zu Spannungen führen, denn praktisch alle Flüsse fließen durch mehrere Länder. Aktuell investiert insbesondere China sehr viel in den Ausbau von Wasserkraftwerken. Auch Indien baut Staudämme, was wiederum die Wasserkapazität im flussabwärts gelegenen Bangladesch beeinflusst.
In den Nachbarländern verändert sich dann der Wasserstand der Flüsse, fruchtbare Sedimente für die Landwirtschaft bleiben aus – und in Konflikten zwischen den Ländern und Regionen könnte die Kontrolle über das Wasser sogar als Waffe eingesetzt werden. In Grundzügen war das sogar bereits der Fall: 2017 z.B. hielt die chinesische Regierung hydrologische Daten aus dem Oberlauf des Brahmaputra gegenüber Indien zurück, in einer Zeit, in der sich indische und chinesische Grenztruppen auf einem Plateau feindselig gegenüberstanden. Man könnte zwar einwenden, hydrologische Daten sind nicht so wichtig – doch gerade in der Monsunzeit haben sie eine erhebliche Bedeutung, um die Wassermassen einschätzen zu können, die flussabwärts ankommen werden und um ggf. die Bevölkerung warnen zu können.

Staudämme verändern den Wasserhaushalt im Fluss und können Konflikte befeuern / © daramsri, pixabay.com
Verbindende Abkommen oder eine internationale Zusammenarbeit im Wasserbereich gibt es in der Region kaum. Internationalen Beobachtern zufolge wären solche wichtig, um künftige Konflikte zu entschärfen.
Und der Klimawandel selbst? Der wird voraussichtlich mehr Niederschläge auf den tibetischen Hochebenen mit sich bringen. Das klingt zunächst positiv – doch das könnte mehr Extremwetter nach sich ziehen. Zu viel Wasser und Überschwemmungen in der Regenzeit, in der Trockenzeit dagegen zu wenig Wasser. Und eben weniger Gletscher, die diesen Verlust ausgleichen können. In Zentralasien etwas weiter nördlich werden ähnliche Prozesse erwartet.
Egal wie man es also betrachtet – es ist von zentraler Bedeutung, den Klimawandel so weit es geht zu begrenzen. Sonst sind die Folgen für die Menschen und Ökosysteme erheblich.

Quellen:
Christoph von Eichhorn, „Das große Tauen“, in: Stefan Mahlke (Hrsg.), „Atlas der Globalisierung – Welt in Bewegung“, 2. Auflage 2019 (S. 12-15)
Wikipedia: „Himalaya“, unter https://de.wikipedia.org/wiki/Himalaya (Zugriff am 1.3.2025)

Eine Story von: Stephanie
Stephanie schreibt ehrenamtlich für die WWF Jugend Community. Sie ist im Redaktions- und Aktionsteam. Auch du kannst hier mitmachen – melde dich gerne bei uns.