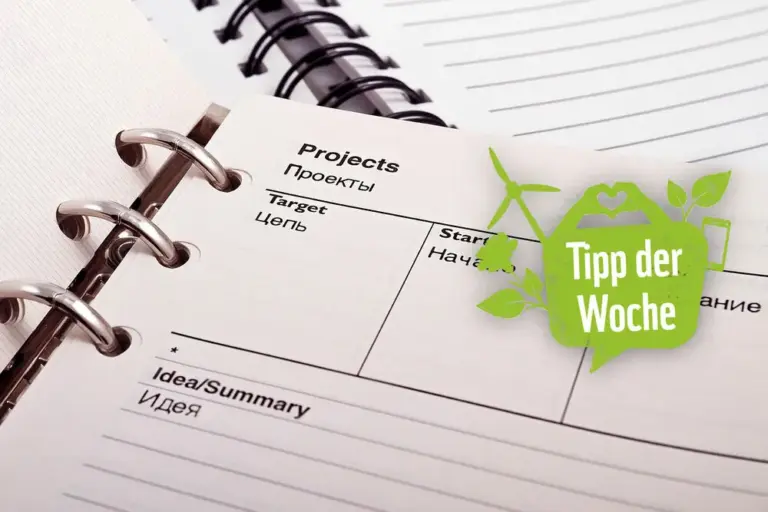In der letzten Story haben wir uns bereits damit beschäftigt, dass Menschen mit Behinderung besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Gleichzeitig sind auch Menschen mit Behinderung Teil der Klimabewegung und bei verschiedenen Aktionen aktiv.
Wir sind alle Gestalter der neuen Welt, wir träumen von einem guten Leben für alle. Warum uns also nicht zusammentun und von- und miteinander lernen und aktiv sein? Die Inklusions- und Klimabewegung haben einige Schnittpunkte und es lohnt sich, die Erfahrungen und Kompetenzen beider Bewegungen zu nutzen und zu verbinden.
Im Folgenden möchten wir einmal genauer schauen: Wie kann die Klimabewegung inklusiver werden? Wie kann sie sich für alle Menschen öffnen?
Bei Fridays for Future, Ende Gelände und anderen Klimabewegungen bzw. in den Umweltverbänden gibt es langsam ein Bewusstsein für Inklusion und Diversität – es ist also etwas in Bewegung, auch wenn noch daran gearbeitet werden muss.
Nicht immer wird es die eine, perfekte Lösung geben. Die Bedürfnisse der Menschen sind sehr unterschiedlich und können sich ggf. auch wiedersprechen. Es ist wichtig, offen damit umzugehen. Doch werden verschiedene Aktions- und Beteiligungsformate angeboten, kann sich jeder Mensch das am besten passende auswählen und sich in unterschiedlichen Bereichen einbringen und engagieren.
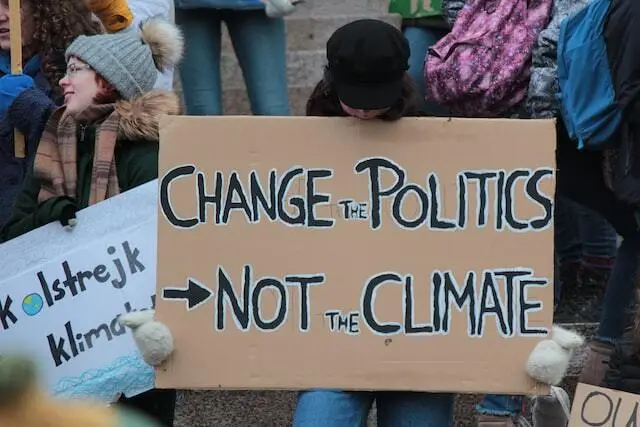
Förderliche und hinderliche Faktoren
Bisher werden Menschen mit Behinderung im Klimaschutz und bei Aktionen noch zu wenig mitgedacht. So gibt es z.B. kaum deutschsprachiges Material in Leichter Sprache, das über den Klimawandel informiert. (vgl. Anmerkung 1). Informationen sind – bis auf wenige Ausnahmen – nur in schwerer Sprache vorhanden. Damit haben wir bereits einen wichtigen Punkt, der viele Menschen ausschließt – denn gerade für Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch für Menschen mit (noch) nicht guten Deutschkenntnissen ist Leichte Sprache eine Voraussetzung, um an Informationen zu kommen.
Auch Infos zu Veranstaltungen oder Aktionen sind in der Regel nur in schwerer Sprache vorhanden. Hinzu kommt, dass Infos vielfach nur in bestimmten Gruppen und über bestimmte Kanäle weitergegeben werden – Gruppen und Kanäle, in denen Menschen mit Behinderungen durch verschiedene Faktoren nicht oder wenig vertreten sind. D.h., die Infos erreichen primär Menschen ohne Behinderung. Diese Strukturen erschweren Inklusion bereits im Vorfeld.
Ein weiteres Hindernis: In den Orga-Teams von Organisationen, Aktionen und Veranstaltungen sind nur sehr selten Menschen mit Behinderungen vertreten. Das wirkt sich dann auf die Veranstaltung aus. Denn Barrieren können am leichtesten bereits bei der Planung beseitigt werden. – Wenn man daran denken würde.
Auch Veranstaltungen sind oft nicht barrierefrei. Ein prominentes Beispiel ist z.B. die letzte COP in Glasgow – es gab keinen barrierefreien Zugang zur Konferenz. Obwohl die Klimakonferenz von der UN veranstaltet wird, die auch das Übereinkommen der Rechte der Menschen mit Behinderung vorangetrieben hat.

An Rampen und Aufzüge wird noch vergleichsweise häufig gedacht, wenn es um Barrierefreiheit geht. Doch das ist natürlich nicht alles. So werden z.B. Redebeiträge bei Klimastreiks nicht in allen Städten in Gebärdensprache gedolmetscht, bei Vorträgen gibt es noch seltener Gebärdendolmetschung, und auch über eine induktive Höranlage verfügen nur wenige Räume (verbessert die Übertragung auf Hörgeräte).
Oder, wie bereits erwähnt, werden Menschen mit Behinderungen bereits im Vorfeld unzureichend erreicht und erfahren weniger von der Veranstaltung. Infomaterial in Leichter Sprache fehlt.
Konkrete Barrieren in Gebäuden können z.B. fehlende/defekte Aufzüge, Treppen, fehlende Haltegriffe in Sanitärräumen, zu kleine WCs oder unbefestigte, steile Wege auf dem Gelände sein.
Bei einem Camp können auch die Seile der Zelte eine Barriere für Menschen mit Mobilitäts- oder Sehbehinderung darstellen. Oder eine Teilnahme wird dadurch erschwert, eine geeignete Assistenz für diese Zeit zu finden und zu finanzieren. Auf einige dieser Barrieren hat die Klimabewegung Einfluss, auf andere weniger.
Bauliche Barrieren sind für Menschen ohne Behinderung oft noch gut nachzuvollziehen. Schwieriger wird es bei nicht sichtbaren Barrieren. Diese geraten leicht aus dem Blick. Besonders wichtig sind hier der barrierefreie Zugang zu Informationen und eine barrierefreie Kommunikation.

Bei Plakaten, Infotafeln u.ä. kann z.B. auch mit QR-Codes gearbeitet werden: Über den aufgedruckten QR-Code lässt sich ein Video abrufen, das den Inhalt in DGS (Deutscher Gebärdensprache) oder leichter Sprache zugänglich macht. – Denn Gebärdensprache ist für die meisten gehörlosen Menschen die Muttersprache, die deutsche Schriftsprache wird wie eine Fremdsprache erlernt.
Eine weitere Hilfe in der Kommunikation stellen Piktogramme dar. Sie machen Infos zugänglich, ohne dass man lesen können muss. Besonders relevant sind Piktogramme z.B. bei Programmen, Abläufen oder bei der Orientierung auf dem Gelände und der Beschilderung von Räumen. Wann ist was? Wo ist was? – Diese Infos werden u.a. dadurch zugänglich.
Ein Programm mit großer Schrift und in leichter Sprache ist ebenfalls empfehlenswert.
Es darf auch nicht vergessen werden, dass es nicht sichtbare Behinderungen gibt. Das können z.B. Hör- oder Sehbehinderungen sein, Lernbehinderungen, Autismus oder chronische körperliche sowie psychische Erkrankungen.
So braucht es z.B. auch Konzepte für Menschen, die nicht lange sitzen oder lange stehen können oder einen Rückzugsraum benötigen. Bei Klimacamps und anderen Aktionen draußen auch ausreichend Schatten.

Positive Beispiele
Menschen mit Behinderungen wollen genauso bei Aktionen mitmachen wie andere. Ein gutes Beispiel ist z.B. der „bunte Finger“ bei „Ende Gelände“. Hier sind Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam aktiv und unterstützen sich bei Barrieren. Erprobt werden soll auch ein Buddy-System: Vor der Aktion können sich Menschen melden, die Assistenz benötigen oder leisten können. Auch für Klimacamps hat Ende Gelände einige hilfreiche Einrichtungen ermittelt, die Barrieren abbauen und die Teilnahme möglichst vieler Menschen ermöglichen. Dazu gehören z.B. ruhigere Räume, Feldbetten, Lademöglichkeiten für E-Rollstühle oder eine Kühlmöglichkeit für Medikamente usw.
Auch das BiPoC-Klimacamp der BUND-Jugend NRW hat ebenfalls auf Barrierefreiheit geachtet und gezielt auch Menschen mit Behinderungen angesprochen. Einige Schlafgelegenheiten waren z.B. barrierefrei zugänglich und es gab die Möglichkeit, weiteren Bedarf (z.B. Gebärden-Dolmetscher) bei der Anmeldung zu vermerken.
Ein weiteres Beispiel ist die Stiftung Friedehorst in Bremen. Hier wurden Menschen mit Behinderung zu Klimascouts ausgebildet und es werden verschiedene Projekte, Exkursionen, Bildungsangebote usw. durchgeführt, die Klimaschutz und Inklusion zusammenbringen.
Im Bereich der Naturschutzeinsätze setzt sich z.B. das Bündnis Nationale Naturlandschaften e.V. dafür ein, dass alle Menschen teilnehmen können. Es gibt Infomaterial und Workshops in leichter Sprache. Das Motto? Ungehindert engagiert.
In der Corona-Zeit wurden viele (Umwelt-)Bildungsangebote online durchgeführt. Das hat einige Menschen die Teilnahme ermöglicht, die sonst nicht an einem solchen Angebot hätten teilnehmen können.

Soziale Medien
Bei der Nutzung von sozialen Medien muss z.B. daran gedacht werden, dass es Bildbeschreibungen gibt und dass unterschiedliche Kommunikations- und Wahrnehmungsebenen angesprochen werden. Infos müssen z.B. visuell und auditiv zugänglich sein. Gerade Grafiken, Flyer oder Sharepiks sind nicht für alle Menschen wahrnehmbar. Die Infos sollten also auch auf anderem Weg verfügbar sein.
Ein weiteres Thema sind Audiobeschreibungen (sie beschreiben, was im Film zu sehen ist und machen ihn für sehbehinderte/blinde Menschen zugänglich) sowie Untertitel bei Videos oder eingeblendete Gebärdendolmetschung.
Ebenso hilfreich sind Protokolle/Mitschriften, die besprochene Infos zugänglich machen. – Nicht jedem Menschen gelingt es, gleichzeitig dem Vortrag zu folgen und parallel zu schreiben.
Bei schriftlichen Dokumenten, egal ob print oder digital, sind Schriftart und Schriftgröße relevant sowie deutliche Kontraste. Auch die Sprache sollte einfach und klar gehalten werden. Bei Internetseiten ist es hilfreich, wenn Schriftgröße und Kontrast bei Bedarf angepasst werden können. Auch Newsletter sollten in diese Überlegungen einbezogen werden. Es macht z.B. keine Freude, einen Newsletter zu lesen, dessen Schrift so klein ist, dass man sie kaum entziffern kann.

Willkommenskultur ist wichtig
Am Wichtigsten ist jedoch eine Willkommenskultur – Klimaorganisationen sollten offen sein für und gegenüber Menschen mit Behinderungen.
Ein großer Schritt ist bereits getan, wenn Klimaaktivist:innen die Zugänglichkeit für alle Menschen mitbedenken. Die Menschen sind bunt und vielfältig – so sollte auch die Klimabewegung sein.
Dazu braucht es den Willen, dass politische Forderungen so gestaltet sind, dass alle Menschen mitgenommen und keine Gruppe ausgeschlossen wird.
Auch sollte Menschen mit einer Behinderung, die im Klimaschutz aktiv werden wollen, keine Rolle zugeschrieben werden. Wie bei allen anderen Menschen, soll die Art des Aktivismus frei gewählt werden können. Z.B. muss eine mobilitätseingeschränkte Person nicht zwangsläufig Aufgaben in der Organisation und am Telefon übernehmen – möglicherweise möchte die Person lieber als Kletteraktivist:in aktiv werden. Seid kreativ, legt Denkmuster ab, lasst jede Person dort aktiv werden, wo er/sie sich am liebsten einbringen möchte, nehmt Ideen auf – wie bei Menschen ohne Behinderung auch.

(Klima-)Aktivismus braucht Kraft
Wenn viel Kraft in eine Sache gesteckt wird, bleibt keine Kraft mehr für anderes. Z.B. erfordert die Teilnahme an einem Streik, Klimacamp, Naturschutzeinsatz oder mehrtägigem Workshop für Menschen mit Behinderungen oft einen zusätzlichen Aufwand an Organisation und einen längeren zeitlichen Vorlauf, um Barrierefreiheit und ggf. Unterstützung bei der Anreise und vor Ort sicherzustellen. So bleibt weniger Energie übrig, um am Programm teilzunehmen. – Stellt euch das so vor: Jede Person hat nur eine begrenzte Anzahl an „Löffeln“ zur Verfügung, und diese sind dann für das Drumherum des Aktivismus und für den Alltag oftmals bereits aufgebraucht (Löffeltheorie).
Für Menschen mit Behinderungen ist es oft doppelter Aktivismus, in der Klimabewegung aktiv zu werden – einmal sind sie für das Klima aktiv und gleichzeitig auch oft, um in der Klimabewegung ein Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schaffen.
Das Engagement hängt auch oft davon ab, ob und in welchem Umfang eine gute Assistenz vorhanden ist. Gerade bei Klimastreiks könnten hier Menschen mit Assistenzbedarf und Menschen, die ohnehin am Klimastreik teilnehmen wollen und in einem anderen Bereich evtl. schon Assistenz leisten, besser zusammengebracht werden.

Fazit
Die Klima- und die Inklusionsbewegung setzen sich beide mit Gerechtigkeit auseinander. Es gibt Überschneidungen bei Themen wie der Verkehrswende und natürlich bei Klimaschutz-Aktionen, bei denen Menschen mit Behinderungen dabei sind. Wir haben einige positive Beispiele für inklusiven Klimaaktivismus kennengelernt.
Es ist wichtig, dass wir weiter miteinander reden und voneinander lernen. So können wir immer mehr Menschen erreichen und Aktivismus für alle möglich machen.
Das wichtigste ist Offenheit und das Ziel, alle Menschen beim Klimaschutz mitzunehmen. – Es geht, wenn man will. Für manche Barrieren braucht es lediglich Sensibilität, für andere mehr oder weniger viel Geld.
Wir Menschen mit Behinderungen können und wollen mitreden. Wir haben viel Wissen und Erfahrung, was es für einen inklusiven Klimaschutz braucht. Es sind große Herausforderungen und Schwierigkeiten zu bewältigen – doch gemeinsam können wir das schaffen!

Anmerkung 1: Zu Klimawandel/Umweltschutz sind mir folgende Veröffentlichungen in Leichter Sprache bekannt (Stand September 2022):
- Public Climate School (Frühling 2022) von Fridays for Future: Schulmaterial in leichter Sprache.
- „Klimaschutz für jeden Tag – Ein Ideen-Buch in Leichter Sprache“ von Jessika Knauer und Ulrike Bruckmann
- CJD Erfurt, Heft „Umweltschutz für jeden Tag“ (kostenloser Download)
- Nationale Naturlandschaften e.V. (Bündnis der Großschutzgebiete in Deutschland) hat Lernmaterial/Broschüren in leichter Sprache, u.a. zum Klimaschutz, zu verschiedenen Tieren und Lebensräumen (kostenloser Download)
Wer Beispiele im Internet sucht, z.B.:
- Klimawandel – was bedeutet das? https://www.wortundidee.de/klimawandel-in-leichter-sprache/
- zum letzten Klimastreik hat z.B. der MDR einen Beitrag in leichter Sprache verfasst https://www.mdr.de/nachrichten-leicht/ls-mitteldeutschland-klimastreik-fridays-for-future-demonstration-100.html
Im Vergleich zu der großen Menge an Büchern und Artikeln in schwerer („normaler“) Sprache sind das sehr wenige.
Quellenangaben:
Konferenz „Klimakrise – ohne uns keine Zukunft“ (16.9.2022 in Wien), veranstaltet vom Österreichischen Behindertenrat (Livestream)
https://dieneuenorm.de/gesellschaft/umweltaktivistin-cecile-lecomte/ (letzter Zugriff am 22.9.2022)
https://www.ende-gelaende.org/bunter-finger-2020/ (letzter Zugriff am 22.9.2022)
https://www.ende-gelaende.org/unsere-barrieren-durchfliessen-infos-zu-barrieren-auf-dem-camp-und-in-aktion-2022/ (letzter Zugriff am 22.9.2022)
https://blog.bundjugend.de/be_hinderungen-in-der-klimagerechtigkeitsbewegung/ (letzter Zugriff am 22.9.2022)

Eine Story von: Stephanie
Stephanie schreibt ehrenamtlich für die WWF Jugend Community. Sie ist im Redaktions- und Aktionsteam. Auch du kannst hier mitmachen – melde dich gerne bei uns.