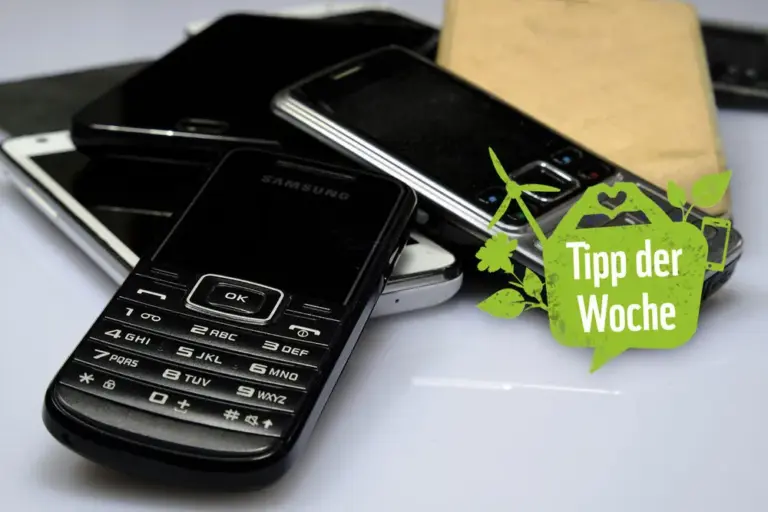Moore haben eine wichtige Funktion, wenn es um die Speicherung von Kohlenstoff geht. Das macht sie zu wahren Helden im Klimaschutz und in der Bekämpfung der Klimakrise. Doch gerade in Deutschland und vielen Ländern Europas sind Moore in einem schlechten Zustand, wurden entwässert und werden land- oder forstwirtschaftlich genutzt.
Brauchen wir also mehr Mut, um unsere Moore zu schützen und degradierte Moore wiederherzustellen?

Moorschutz braucht Mut – und Wörter, um diesen Lebensraum zu beschreiben. / © Psubraty, pixabay.com
Die Bedeutung von Sprache
Wenn man an Naturschutz oder die Wiederherstellung von Ökosystemen denkt, ist „Sprache“ nicht gerade etwas, das einem dabei in den Sinn kommt. Ökologische, biologische, technische und finanzielle Fragen stehen im Vordergrund. Doch auch unsere Sprache hat wesentlichen Einfluss auf das, was wir tun, was uns wichtig ist und wie wir die Natur wahrnehmen.
Denn wie unsere Kultur, prägt auch unsere Sprache unsere Beziehung zur Natur. Durch sie wird deutlich, wie wir die Natur wahrnehmen und sie hilft uns, das Erlebte einzuordnen und zu verstehen.
So ist es nicht verwunderlich, dass Kulturen, die eine sehr enge Beziehung zur Natur haben, das auch in ihrer Sprache zum Ausdruck bringen. Sie haben vielfältige, unterschiedliche Wörter für die unterschiedlichen Daseinsformen von Wasser oder Schnee, wo andere Sprachen vielleicht nur ein einzelnes Wort oder wenige Unterscheidungen kennen.
In der deutschen und allgemein in den europäischen Sprachen wird „Natur“ eher als eine Sache, ein Objekt gesehen. Es ist schwierig, das ganz eigene Wesen der Natur, des Wassers, der Pflanzen, der Steine usw. auszudrücken, wo es – im Unterschied zu manchen anderen Sprachen – in unserem Sprachraum keine Wörter dafür gibt.
Fehlen in einer Sprache bestimmte Begriffe, so zeigt das, dass kein Bedarf hierfür besteht, etwas zu benennen. Oder er zumindest nicht wahrgenommen wird.

Wie viele Menschen können sich unter dem Begriff „Wollgras“ etwas vorstellen? / © Oldiefan, pixabay.com
Aber was hat das mit Moorschutz zu tun? In der deutschen Sprache unterscheiden wir verschiedene Moortypen (Hochmoor, Niedermoor, Sümpfe, …). In unserem Nachbarland Dänemark dagegen gibt es für all das nur ein Wort: „Mose“, was ungefähr Moor bedeutet. Was Sprachschüler:innen vielleicht erfreuen mag – nur ein Begriff muss gelernt werden, und man muss die genauen Unterschiede der Wörter nicht kennen – sagt aber etwas über den Zustand der Moore und ihre Bedeutung in der Gesellschaft aus. Was nicht benannt werden muss, braucht keine Wörter. Die Lebensräume sind verschwunden und mit ihr die Wörter, um sie zu beschreiben.
Doch andersherum: Wie können Moore renaturiert, wie können Naturflächen wiederhergestellt werden, wenn es dafür an Wörtern fehlt? Wie kann den Menschen deutlich gemacht werden, wozu Moorschutz gut ist, welche vielfältigen Lebensräume es gibt, welche Fülle an Leben sie bergen können?
Trotz dieser Hürden setzen sich viele Menschen in Europa dafür ein, dass intakte Moore erhalten und zerstörte Moore wiederhergestellt werden. Sie beweisen Mut und stellen sich immer wieder gegen Widerstände – von der Politik, von Geldgebern, von Anwohner:innen, von Landwirt:innen.
Sie leisten wichtige Überzeugungsarbeit, sie bringen den Menschen Worte näher und helfen mit, diese Worte mit Leben, mit Bedeutung zu füllen. Genauso, wie sie wieder Torfmoose ansiedeln, siedeln sie auch neue Wörter in der Sprache an, wie sie den Wasserstand im Moor anheben, heben sie das Wissen über die entsprechenden Begriffe. So, wie sie die Torfbildung anregen, kurbeln sie auch die Sprachbildung und das Wissen über den Wert der Moore an.
Immer wieder gehen sie mutig voran, experimentieren mit neuen Ansätzen – und zeigen, wie Naturschutz, Moore, Renaturierung und Sprache zusammenhängen.
Drücken wir die Daumen, dass nicht nur die Natur im Ökosystem Moor, sondern auch die sprachliche Vielfalt an Begriffen, um sie zu beschreiben, zurück in unsere Mitte kommen.
Quellen:
NABU Moor-Post 2/2024: „Sprachlosigkeit – und unser Verhältnis zur Natur“

Eine Story von: Stephanie
Stephanie schreibt ehrenamtlich für die WWF Jugend Community. Sie ist im Redaktions- und Aktionsteam. Auch du kannst hier mitmachen – melde dich gerne bei uns.