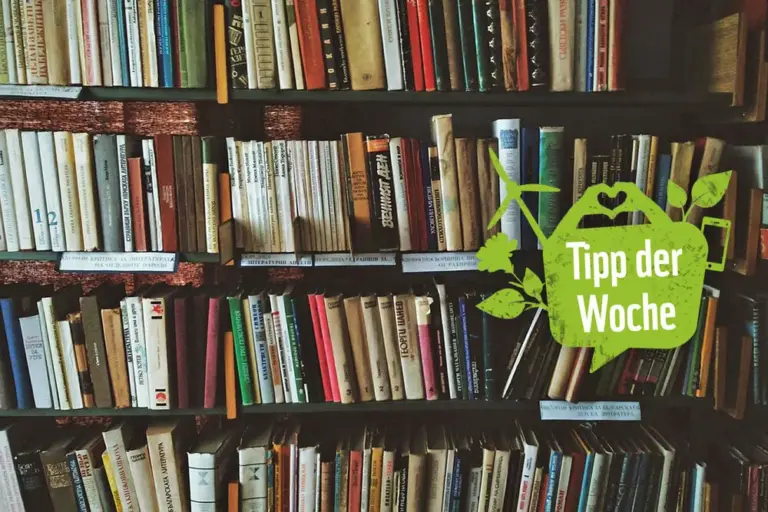Moore sind nicht nur faszinierende Ökosysteme, sondern wahre Klimaschützer! In dieser Story erfährst du, welche Rolle Moore beim Klimaschutz spielen und warum es wichtig ist, sie zu schützen und wiederherzustellen.
Was sind Moore?
Moore sind eine spezielle Form von Feuchtgebieten, die auf allen Kontinenten vorkommen. Moore sind Ökosysteme, die ständig mit Wasser gesättigt sind. Das heißt, sie können nur dort entstehen, wo ausreichend Wasser vorhanden ist. Ob es sich dabei um Quellwasser, häufigen Regen, hoch stehendes Grundwasser, Stau- oder regelmäßiges Hochwasser handelt, ist zunächst egal. Doch die unterschiedlichen Wasserquellen führen zu unterschiedlichen Moortypen wie Hochmoor, Niedermoor oder Zwischenmoor. Allen gemeinsam ist aber, dass Moorböden durch den hohen Wasseranteil wenig Sauerstoff enthalten. Und das wiederum führt dazu, dass sich in den Böden Torf bildet – ein weiteres Merkmal von Mooren. Torf ist Pflanzenmaterial, das sich durch die wassergesättigten, sauerstoffarmen Bedingungen nur teilweise zersetzt hat und sich mit der Zeit anreichert. So ein Torfboden wächst extrem langsam: In einem Jahr nur etwa einen Millimeter. Für eine 10 cm dicke Schicht braucht es also 100 Jahre, für einen Torfboden mit einem Meter rund 1000 Jahre. Dieser Torf ist es auch, der den Mooren ihre große Bedeutung in Bezug auf den Klimawandel verleiht.

In Mooren regelmäßig zu finden: verschiedene Moorgräser / © pixabay.com
Ökosystem Moor
Moore sind spannende Ökosysteme. Sie bieten einzigartigen Tieren und Pflanzen Lebensraum und erbringen wertvolle Leistungen für uns Menschen. Z.B. sorgen Moore für sauberes Wasser und binden klimaschädliches Kohlendioxid.
Je nach Moortyp sind der Kalk-, Nährstoff- und Säuregehalt unterschiedlich. Das wirkt sich auf die Flora des Moors aus. Je nach Moortyp wachsen also unterschiedliche Pflanzenarten, die an diese ganz speziellen Bedingungen angepasst sind und eine ganz charakteristische Zusammensetzung von Pflanzenarten bilden.
Typische Moorpflanzen sind z.B. Seggen, Moorbirke, Schilf, Torfmoos, Erle, Wollgras, aber auch Sonnentau, gemeine Moosbeere und viele mehr. Und je nach dem, welche Pflanzenarten vorherrschen, werden auch unterschiedliche Torfarten gebildet – es gibt z.B. Holztorf, Seggentorf, Schilf- oder Torfmoos-Torf.

Mehr als die Hälfte der Arten, die als selten gelten oder vom Aussterben bedroht sind, sind in Feuchtgebieten wie z.B. Mooren beheimatet. In den Moorökosystemen finden sie vielfältige, und oft extreme Lebensbedingungen: hoher Wassergehalt, niedriger Sauerstoffgehalt, geringe Nährstoffkonzentration. Moorpflanzen und –tiere haben sich daran angepasst und sind hoch spezialisiert.
Doch in Deutschland und auch weltweit sind Moore gefährdet. In Deutschland ist nur ein kleiner Teil der Moore intakt – über 95% der Moore hierzulande sind zerstört, sogar 98% sind in einem Zustand, der nicht mehr ihrem natürlichen Zustand entspricht. Die Trockenlegung von Mooren und der Torfabbau haben erhebliche Konsequenzen für das Ökosystem Moor: denn oft wird es dadurch komplett zerstört, die dort heimischen Tier- und Pflanzenarten verlieren ihren Lebensraum und das Moor kann seine Ökosystemleistungen nicht mehr ausführen.
Im internationalen Vergleich hat Deutschland mit die am meisten zerstörten Moorflächen.

Moor muss nass sein – dann ist es intakt und ein wertvoller Baustein für den Klimaschutz. / © Marisa04, pixabay.com
Moorschutz ist Klimaschutz
Moore spielen eine wichtige Rolle, wenn es um den Klimaschutz geht. Denn sie sind eines der wenigen Ökosysteme, die dazu in der Lage sind, organisches Material anzusammeln und damit dauerhaft Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu ziehen und im Boden zu speichern. Das macht Moore zu riesigen Kohlenstoffspeichern und verleiht ihnen eine besondere Bedeutung im Klimaschutz.
Wie Torf entsteht und warum Moore wichtig für das Klima sind, erfährst du in diesem Video von Logo! (Dauer 1:33 Min, deutsch, Untertitel zuschaltbar):
Doch viele Moore wurden im Laufe der Zeit entwässert. Oft geschah dies, um die Flächen für die Landwirtschaft zu nutzen.
Wird ein Moor jedoch entwässert, wird der Kohlenstoff, der über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende im Moor gespeichert war, freigesetzt: Da dem Moor das Wasser entzogen wird, gelangt Sauerstoff an den Torf. Die Pflanzenteile im Torf fangen nun an zu verrotten – und der in den Pflanzenresten gespeicherte Kohlenstoff gelangt wieder in die Atmosphäre. Moore werden dadurch von der Kohlenstoffsenke zur Kohlenstoffquelle. Trockengelegte Moore tragen also zum Klimawandel bei: Aus ihnen entweichen jedes Jahr gut 5% der menschengemachten CO2-Emissionen.
Gleichzeitig sind zerstörte, entwässerte Moore nicht mehr in der Lage, Torf zu bilden und dadurch Kohlenstoff aus der Atmosphäre einzulagern.
Moore bedecken zwar nur etwa 3% der weltweiten Landoberfläche – doch intakte Moore speichern mehr Kohlenstoff als alle anderen Vegetationsarten der Welt zusammen.
In Deutschland bedecken Moore etwas weniger als 5% der Fläche – doch sie speichern so viel Kohlenstoff wie alle Wälder in ganz Deutschland zusammen.
¾ der entwässerten Moore werden in Deutschland für die Land- und Forstwirtschaft genutzt. Und diese Moorflächen machen 5,3% der deutschen Treibhausgasemissionen aus. Werden diese Moore wieder vernässt, ist der Verlust für die Landwirtschaft gering – doch der Gewinn für den Klimaschutz enorm.
In der EU liegen z.B. nur 3% der Landwirtschaftsflächen auf Moorböden – doch diese 3% verursachen 25% aller Emissionen aus der Landwirtschaft. Dabei wären mit der Paludikultur Moorschutz und landwirtschaftliche Nutzung sogar vereinbar.

Heutzutage werden Moore nicht nur als Land- und Fortwirtschaftsflächen genutzt, der Torf ist auch im Gartenbau äußerst beliebt. Torf wird nicht nur für Blumenerde – Freizeitgärtner:innen in Deutschland kaufen jährlich über 3.000.000 Kubikmeter Torf – und den erwerbsmäßigen Anbau von Gemüse usw. verwendet, sondern auch in der Papierindustrie (Kartons und minderwertige Papiersorten), der Lebensmittelindustrie (als Wasserfilter, Geschmacksverstärker etc.), der Metall-, chemischen und der Textilindustrie und einigen Bereichen mehr.
Und nicht vergessen: Auch Braun- und Steinkohle ist Torf, der viele Millionen Jahre alt ist und den wir in unseren Kohlekraftwerken verbrennen.
Daneben spielen auch Moorbrände eine Rolle: So haben z.B. Moorbrände alleine in Indonesien 1997 bis zu 2,75 Gigatonnen Kohlenstoff freigesetzt. Das entspricht fast 40% der durchschnittlichen globalen Emissionen aus fossilen Brennstoffen. Große Moorbrände tragen damit ganz wesentlich zum Anstieg von CO2 in der Atmosphäre bei. Schwellbrände im Moor können dabei über Monate anhalten und sind kaum zu löschen – selbst tagelanger Regen oder eine schneebedeckte Fläche reicht nicht aus, um sie zu unterbrechen. – Eine Gefahr übrigens, die in intakten Mooren kaum droht.

Fazit
Intakte Moore zu schützen und zerstörte Moore wiederherzustellen ist also von zentraler Bedeutung, um der Klimakrise etwas entgegen zu setzen und die Klimaziele zu erreichen. Im Vergleich zu anderen Klimaschutzmaßnahmen ist Moorschutz auch noch besonders kostengünstig und sehr effizient. Und neben dem Klima profitieren auch bedrohte Arten vom Schutz der Moore.
Und das Ganze ist noch überaus einfach: Denn der beste Weg, Moore und ihre vielfältigen Ökosystemleistungen zu erhalten, ist der Schutz intakter Moore. Mit anderen Worten: Nichtstun.
Auch die WWF Jugend ist beim Schutz der Moore aktiv. Schaue in den Teams „Natur schützen“ und „Pandas packen an“, wann der nächste Naturschutzeinsatz stattfindet oder lese in den Stories, was bei den bisherigen Einsätzen erreicht wurde!
Quellen:
NABU Deutschland: Kurs „Moore: Faszinierende Ökosysteme als Klimaschützer“, unter https://nabu-wissen.de/courses/4653 (Kurs bearbeitet am 17.11.2024)

Eine Story von: Stephanie
Stephanie schreibt ehrenamtlich für die WWF Jugend Community. Sie ist im Redaktions- und Aktionsteam. Auch du kannst hier mitmachen – melde dich gerne bei uns.