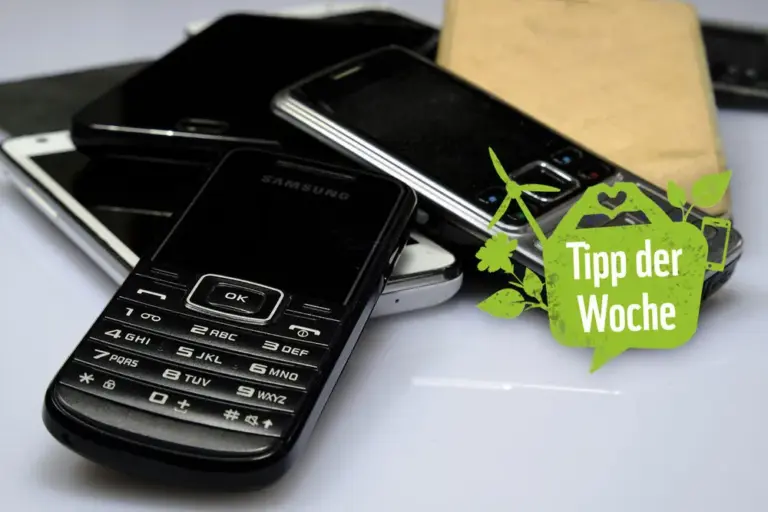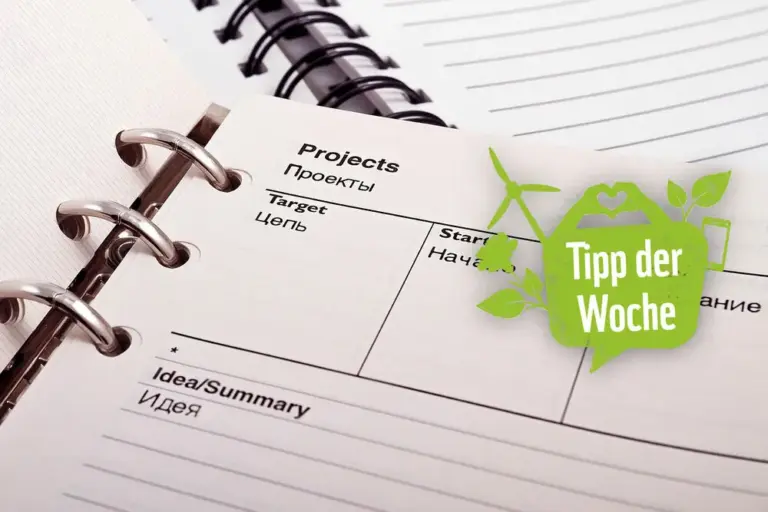Am 3. März war Tag der Artenvielfalt.
Auf der Erde leben unzählige Tiere und Pflanzen. Viele sind noch unerforscht und unentdeckt, besonders Arten in den Regenwäldern oder in der Tiefsee.
Doch leider sterben immer mehr Arten aus. Wir befinden uns im 6. Massenaussterben der Erdgeschichte.
Dieses massenhafte Aussterben von Lebewesen ist genauso schwerwiegend und bedrohlich für unseren Planeten und uns Menschen wie die Klimakrise. Und beide Krisen hängen auch eng zusammen. Unsere Luft, unsere Nahrung, unser Wasser – für all das brauchen wir eine intakte Umwelt und Artenvielfalt.
Doch warum sterben immer mehr Arten aus? Welche Gründe gibt es dafür? Damit wollen wir uns in dieser 2-teiligen Berichtereihe befassen.

Der Entomologe und Biodiversitätsforscher Edward O. Wilson hat dazu das Konzept „HIPPO“ entwickelt.
HIPPO steht für
- Habitatsverlust/-zerstörung
- Invasive Arten
- Pollution (Verschmutzung)
- Population (Bevölkerung)
- Overharvesting (Übernutzung)
Damit bringt Wilson die größten Treiber des Artensterbens in eine Form, die man sich gut merken kann.
Mit dem Habitatsverlust und den invasiven Arten haben wir uns bereits in Teil 1 der Story befasst. Im zweiten Teil geht es nun um die restlichen Aspekte.

Pollution (Verschmutzung)
Unter diesem Punkt können sich bestimmt viele etwas vorstellen. Denn wir Menschen verschmutzen die Erde auf vielerlei Weise. Ein großer Punkt ist hier Plastik. Insbesondere Plastik, das ins Meer gelangt, ist eine Bedrohung für die Artenvielfalt. Hier sind insbesondere auch Fischernetze oder Langleinen etc. zu nennen. Die Tiere verheddern sich darin und sterben. Oder sie verwechseln kleine Plastikteile mit Nahrung. 90% der Seevögel haben bereits Plastikteile im Magen. Sie sterben durch innere Verletzungen, oder weil sie verhungern.
Von Mikroplastik, also kleinsten Plastikteilchen, geht noch eine weitere Gefahr aus: Durch ihre Struktur ziehen Mikroplastikteilchen Gifte und Schadstoffe an. Nehmen Tiere die Plastikteilchen auf, reichern sich die Gifte in ihnen an. Dadurch kann es z.B. zu Störungen bei der Fortpflanzung oder beim Wachstum kommen. Für gefährdete Arten ist das gravierend.
Auch in Insekten wurde bereits Mikroplastik nachgewiesen – und über Insekten gelangt es in die Nahrungskette weiterer Tiere, z.B. Vögel, Frösche usw.
Natürlich wird die Umwelt nicht nur durch Plastik verschmutzt. Pestizide, Dünger und Arzneimittel sind weitere wichtige Faktoren. Ca. 80% der Pestizide sind Herbizide (giftig für Pflanzen), 20% sind Insektizide (giftig für Insekten) und Fungizide (giftig für Pilze). Damit ist die Agroindustrie der größte chemische Verschmutzer unserer Lebensräume. Die meisten Pestizide werden auf großen Monokulturen ausgebracht – doppelt schlecht für die Artenvielfalt.
Besonders gefährdet durch Pestizide sind Insekten. Aktuell sind bereits ca. ¾ der Bienen und anderen Insekten ausgestorben. Doch auch Käfer, Fliegen, und Würmer sind besonders gefährdet. Da Ackergifte über Wasser und Wind transportiert werden können, vergrößert sich die Wirkung auf die Artenvielfalt über das jeweils behandelte Feld hinaus.
Spinnen, Vögel, Fledermäuse sowie alle Tiere in der weiteren Nahrungsquelle werden durch Pestizide geschwächt. Das Gift reichert sich in den Tieren an und kann bis zum Tod führen.
Weniger berücksichtigt wird, dass Gifte im Boden natürlich auch die Mikroorganismen gefährden. Sie sorgen für einen gesunden, fruchtbaren Boden.

Ebenfalls häufig in der Landwirtschaft eingesetzt werden Phosphatdünger. Und auch sie haben negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt: Ein großer Teil des Phosphats wird aus den Böden ausgewaschen und gelangt in die Gewässer. Dort führt er zu einem Überschuss an bestimmten Nährstoffen und einem ungebremsten Wachsen bestimmter Pflanzen. Die Folgen sind Algenblüten und sogenannte dead zones, Zonen mit sehr geringem Sauerstoffanteil, in denen kaum noch Leben möglich ist. Leider dehnen sich die dead zones aus und gefährden immer mehr maritime Lebensräume.
Doch auch Dünger mit Nitrat oder das Ausbringen von Gülle aus der industriellen Tierhaltung führt zu Problemen, weil sie das Grund- und Oberflächenwasser gefährden.
Überall auf der Welt gelangen auch Arzneimittel in die Umwelt. Schmerzmittel, Antibiotika, Betablocker, psychoaktive Substanzen etc. gefährden Frösche und andere Tiere. Das kann zu Fehlbildungen oder Störungen bei der Fortpflanzung führen.
Gut die Hälfte der Antibiotika wird übrigens in der industriellen Tierhaltung eingesetzt, nur die andere Hälfte beim Menschen.
Gelangen Antibiotika-Rückstände in den Boden und ins Wasser, werden unzählige Bakterien im Boden abgetötet und es können resistente Bakterienstämme entstehen.

Daneben gibt es noch weitere Verschmutzungen, die sich auf die Artenvielfalt auswirken. Das sind z.B.
- Atomunglücke wie z.B. in Fukushima oder Tschernobyl: Auch bei Tieren und Pflanzen kann es durch die Strahlenbelastung zu Fehlbildungen, Tumoren, genetischen Veränderungen kommen. Da Tiere und Pflanzen nicht umgesiedelt werden, wirken sich diese Belastungen über Jahrzehnte aus.
- Mikrowellen/Mobilfunkstrahlung: Es gibt kaum noch Gebiete ohne Mobilfunkstrahlung. Besonders hochfrequente Strahlung kann bei Insekten oder Vögeln das Verhalten beeinflussen oder zu Veränderungen im Stoffwechsel führen.
- Bienen reagieren besonders empfindlich auf elektromagnetische Strahlung. Denn ihr Körper verfügt über Halbleiterfunktionen und Magnetidgranulat. Das hilft ihnen bei der Orientierung. Durch Strahlung kann die Orientierung der Bienen eingeschränkt sein, sie finden z.B. nicht mehr nach Hause oder haben ein anderes Verhalten beim Wabenbau oder ein geschwächtes Immunsystem.
- Gentechnik: Der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen gefährdet die natürliche Vielfalt an Genmaterial. Die Artenvielfalt ist über Jahrtausende entstanden und hat einen Genpool ausgebildet, der durch GVO gefährdet wird. Denn GVO-Pflanzen breiten sich über Pollenflug auf andere Pflanzen aus. Eingesetzt werden genveränderte Pflanzen überwiegend in der Futtermittelindustrie (Soja), aber auch bei Baumwolle oder Eukalyptus. Tierarten kommen bei der Bestäubung mit den GVO in Kontakt oder ernähren sich von ihnen.
- Sonar- und Lärmbelästigung an Land und im Wasser: Besonders Wasserlebewesen sind von Belästigungen durch Lärm gefährdet. Lärmquellen (Schifffahrt, Bohrungen, Ölplattformen, Sonargeräte des Militärs) können z.B. die Orientierung oder Kommunikation der Tiere einschränken oder die Nahrungssuche erschweren. Durch Sonargeräte kommt es immer wieder zu Massenstrandungen von Walen und Delfinen.

Population (Bevölkerung)
Auch die Anzahl der Menschen gefährdet die Artenvielfalt. Die (Über-)Bevölkerung lässt sich nicht isoliert betrachten. Sie verstärkt die anderen Faktoren, die den Verlust an Artenvielfalt fördern: Mehr Menschen brauchen mehr Platz, mehr Nahrung, verändern mehr Land, halten mehr Nutztiere, bauen mehr Ressourcen ab, konsumieren mehr, stoßen mehr CO2 aus, verschmutzen die Umwelt mehr, treiben mehr weltweiten Handel, brauchen mehr Energie usw.
Der erhöhte Konsum und die Übernutzung aller Lebensbereiche nehmen zu, je mehr Menschen auf der Welt leben. Der Besiedlungsdruck wächst. Schon länger ist der Mensch der entscheidende, gestaltende Faktor auf der Welt und verändert Lebensräume nach seinen Vorstellungen. Tiere und Pflanzen können immer weniger ausweichen.
Dabei kommt es in erster Linie auf den Lebensstil der Menschen und ihre Art zu wirtschaften und Ressourcen zu nutzen an und erst in zweiter Linie auf die tatsächliche Anzahl der Menschen.
Ein wirksames Mittel, um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, liegt übrigens in der gezielten Bildung und Stärkung von Mädchen und Frauen. Haben Mädchen und Frauen einen besseren Zugang zu Bildung, Ausbildung, Arbeit und Gesundheitsinformationen, sinkt die Geburtenrate.

Overharvesting (Übernutzung, Überkonsum)
Die Übernutzung der natürlichen Ressourcen hängt eng mit der Bevölkerungsanzahl und der Art zu wirtschaften und zu leben zusammen.
Insbesondere die Bereiche Ernährung, Konsum und Energie verbrauchen oft mehr Ressourcen, als die Erde nachhaltig bereitstellen kann. So werden Tiere bis zu ihrem Aussterben gejagt, die Ozeane sind stark überfischt, die industrielle Landwirtschaft braucht immer mehr Land für ihre Monokulturen. Das alles gefährdet die Artenvielfalt direkt (Jagd, Fischfang, Beifang) oder indirekt (Verlust von Lebensräumen durch Landnutzungsänderungen, industrielle Landwirtschaft, Abholzung).
Betrachtet man die Rote Liste, so sind 72% der erheblich bedrohten Arten aufgrund der Übernutzung durch den Menschen bedroht. Wenn es keine oder weniger Übernutzung geben würde, würde sich das also unmittelbar auf den Bestand an Arten auswirken.

Nicht nur die Ozeane sind übernutzt, auch viele unserer Böden. Durch die industrielle Landwirtschaft werden die Böden stark beansprucht, Mikroorganismen und Bodenlebewesen gefährdet.
Doch auch der Abbau von Mineralien und Erzen hat verheerende Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt. Ganze Ökosysteme können hier ausgerottet werden. Es werden gigantische Mengen an Material umgeschichtet, giftige Substanzen wie Quecksilber verbleiben auch nach Aufgabe der Mine in der Region zurück und gefährden Wasser, Tiere, Pflanzen und Menschen.
Auch Wasser ist von Übernutzung betroffen. Insbesondere die Industrie und Landwirtschaft verbrauchen große Mengen Wasser. Oft wird Wasser dabei verschmutzt – durch Pestizide, Gifte, Dünger, Chemikalien, Kunststoffe, Lösungsmittel und vielem mehr. Wenn Flüsse durch zu große Wasserentnahme trockenfallen oder durch Chemikalien etc. belastet sind, hat das Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Die Vegetation verändert sich, Tiere sterben.

Fazit
Nun haben wir uns mit allen 5 Bereichen, die das Artensterben beschleunigen, befasst. Die Abkürzung HIPPO kann eine gute Merkhilfe sein. Sie steht für
– Habitatverlust
– invasive Arten
– Pollution (Verschmutzung)
– Population (Bevölkerung)
– Overhavesting (Übernutzung)
Damit lassen sich die wichtigsten Aspekte gut zusammenfassen. Alles klar?
Quellenangabe
Fred Hageneder: „Happy Planet – Jetzt handeln für eine glückliche Erde“, Neue Erde GmbH, 1. Auflage 2019

Eine Story von: Stephanie
Stephanie schreibt ehrenamtlich für die WWF Jugend Community. Sie ist im Redaktions- und Aktionsteam. Auch du kannst hier mitmachen – melde dich gerne bei uns.