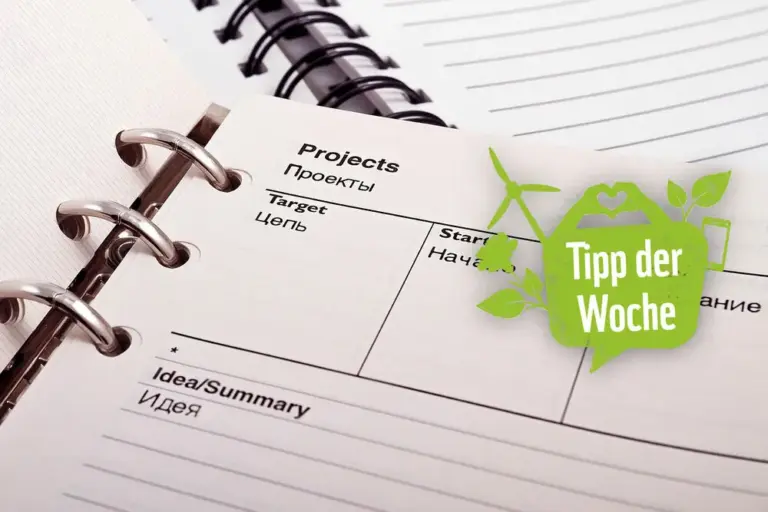Es ist sehr wichtig, dass wir über das Klima sprechen. Doch genauso wichtig ist es, WIE wir es tun. Die Wörter, die wir verwenden, transportieren Information, aber ebenso Emotionen, mentale Bilder.
In dieser Story wollen wir uns einige Begriffe, die wir in der Kommunikation rund ums Klima häufig verwenden, einmal genauer anschauen: Was wird damit transportiert? Macht es einen Unterschied, ob von „Klimawandel“ oder „Klimakrise“, von „Erderwärmung“ oder „Erderhitzung“ gesprochen wird?
Lasst uns gemeinsam unsere Sprache ein Stück weit hinterfragen.
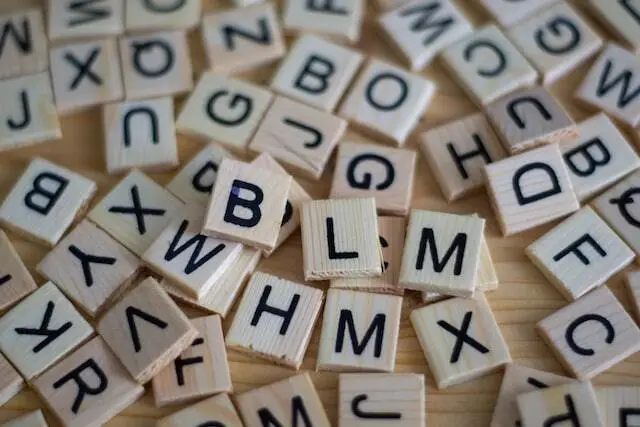
Die Macht der Wörter
Welche Wörter wir wählen, wirkt sich stark darauf aus, wie wir die Welt wahrnehmen. Je nachdem, welches Wort wir benutzen, haben wir gleich ein ganz anderes Bild – vielleicht ein passenderes oder aber ein unpassenderes Bild – im Kopf.
Die Begriffe wecken Assoziationen und lenken unsere Wahrnehmung in eine bestimmte Richtung. Unsere Aufmerksamkeit fokussiert sich auf bestimmte Aspekte, andere werden mehr oder weniger ausgeblendet.
Genauso hat auch das Fehlen von Wörtern eine Wirkung: Für bestimmte Phänomene und Erfahrungen hat Sprache keine Wörter. Wie kannst du dann beschreiben, was du erfahren hast? Leider entweder nicht oder nur ungenaue Umwege.
Es gibt Begriffe in der Klimakommunikation, die die tatsächliche Situation verharmlosen. Dadurch wird dann Klimaschutz ausgebremst oder verringert – da er ja nicht so wichtig, nicht so dringlich ist, die Lage nicht so ernst. Wir müssen also lernen, angemessen darüber zu sprechen.
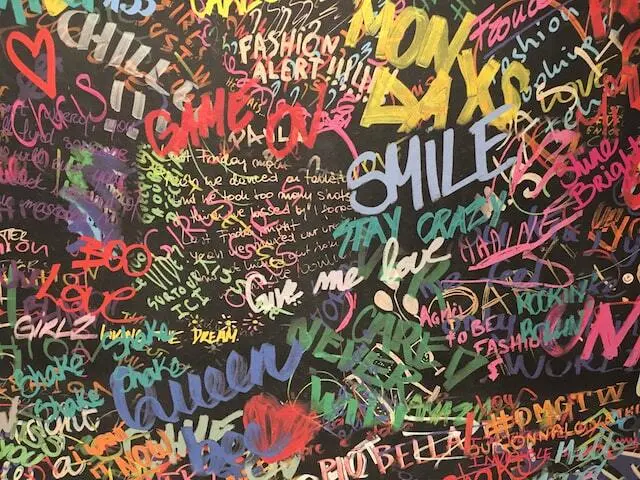
Erderwärmung, Klimakrise oder Klimawandel?
Es ist derzeit die größte Herausforderung für die Menschheit – doch welche Bezeichnung ist eigentlich angemessen?
In den Medien wird meist der Begriff „Klimawandel“ verwendet. Er macht einen neutralen, sachlichen Eindruck. Mit „Wandel“ wird jedoch etwas verbunden, das langsam und unaufgeregt vor sich geht. „Wandel“ ist zunächst einmal neutral, oft ist die Veränderung sogar positiv.
Auch wird mit dem Begriff „Klimawandel“ die Vorstellung gefestigt, dass es sich um einen natürlichen Prozess handelt. So wie sich das Klima in der Erdgeschichte bereits mehrfach gewandelt hat. Nicht dramatisch. Oder…?
Die derzeitige Situation ist aber anders: Das Klima wandelt sich nicht, es wird von uns Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht.
Auch „Erderwärmung“ als Begriff ist eher kritisch. Mit „Wärme“ verbinden wir etwas Angenehmes, wir fühlen uns wohl, wenn es warm ist, vielleicht assoziieren wir damit auch Erholung, Gemütlichkeit. „Warm“ wird sehr häufig verwendet, um etwas besonders positives zum Ausdruck zu bringen: Eine warme Stimme, ein warmes Lächeln. Lauter Sachen, bei denen wir uns wohl fühlen.
Doch für das Klima sieht es anders aus: 2°C Erwärmung sind nicht sonderlich angenehm. „Erderwärmung“ verharmlost die Situation und erzeugt positivere Bilder in uns, als sie in dieser Situation angemessen sind.
Alternativ könnten wir von „Hitze“ bzw. „Erhitzung“ sprechen. Das bildet die Realität besser ab.
Vielleicht würden die Politiker:innen viel entschiedener handeln, wenn das Klima kälter werden würde? Denn mit Kälte ist Unangenehmes verbunden, das wollen wir vermeiden. Frieren möchte niemand gern.
In der Klimadiskussion wird deswegen oft der Begriff „Klimakrise“ verwendet anstatt „Erderwärmung“ oder „Klimawandel“. Oft fordern Aktivist:innen, dass Politiker:innen die „Krise“ anerkennen und entsprechend handeln.
Doch der Begriff „Klimakrise“ ist auch nicht ganz perfekt: Mit dem Begriff wird viel deutlicher, dass es ein Problem ist, und dass man sich damit beschäftigen muss. Das ist in diesem Fall schon mal positiv. Doch auch eine Krise ist nicht zwangsläufig von Menschen verursacht. Oft sind Krisen etwas, die über uns hereinbrechen und für die wir keine Schuld haben. Ein weiterer Aspekt: Eine Krise hat einen Anfang und ein Ende. Ist eine Krise vorbei, können wir danach so weitermachen wie vorher. – Nicht so allerdings bei der Klimakrise.
Trotzdem gibt es gewisse Ähnlichkeiten: Es wird darüber gesprochen, wie ein Land oder eine Stadt klimaneutral werden kann, viel wird über Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen diskutiert. Doch was nicht oder kaum diskutiert wird: Wie wir Menschen leben, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie wir mit anderen Menschen oder den Ökosystemen umgehen. Weiter so wie bisher in diesen Bereichen? Besser nicht.
Und wenn es dann nicht funktioniert mit dem „Klimaschutz“ (wobei auch das ein kritischer Begriff ist: das Klima braucht keinen Schutz. Wir Menschen brauchen den Schutz unserer Lebensgrundlage), dann werden „enttäuschte Umweltschützer:innen“ oder „wütende Aktivist:innen“ bemüht. Was dabei nicht transportiert wird: Ob Klimaschutz-Maßnahmen ausreichen oder nicht, das betrifft den ganzen Planeten und alle Menschen, nicht alleine Umweltschützer:innen und Aktivist:innen.
Ihr merkt bereits: Es ist ganz schön schwierig mit den Wörtern…
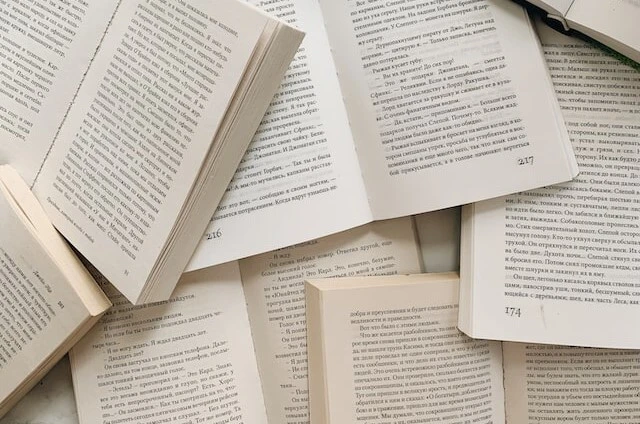
Klima ist komplex
Klima ist ein komplexes Thema und mit „zu viel Kohlendioxid“ noch lange nicht erfasst. Es ist ein Thema, das oft über unser Verständnis von Raum und Zeit hinausgeht, es hat unglaublich viele Aspekte und Ebenen.
„Klima“ durchzieht alle Lebensbereiche, es ist sehr komplex, baut auf unendlich vielen Wirkmechanismen, beeinflusst unser Handeln. Wir Menschen sind Teil des Klimas, doch das Gesamte zu erfassen, gelingt uns kaum. Auf zu vielen Ebenen spielt es sich ab.
Welches Wort passt denn nun?
Aber wie sollten wir es nun bezeichnen? Was ist ein passender Begriff?
„Klimakatastrophe“ ist ein weiterer Begriff. Hiermit werden zumindest die Zerstörung und das Ausmaß der Folgen besser transportiert. Manche sprechen auch von „Klimakollaps“. Oder wie wäre es mit „Systemversagen“?
All diese Wörter sind nicht falsch. Und gleichzeitig scheitern alle Begriffe daran, die ganze Tragweite abzubilden. Das ist auch ganz schön schwer – man bräuchte ein einzelnes Wort, um die ganze Tragweite, alle Bedeutungen und Folgen des Klimas abzubilden. Das schafft nicht ein Wort allein. Sprache ist jedoch wandelbar – vielleicht wird es in Zukunft einen Begriff dafür geben.
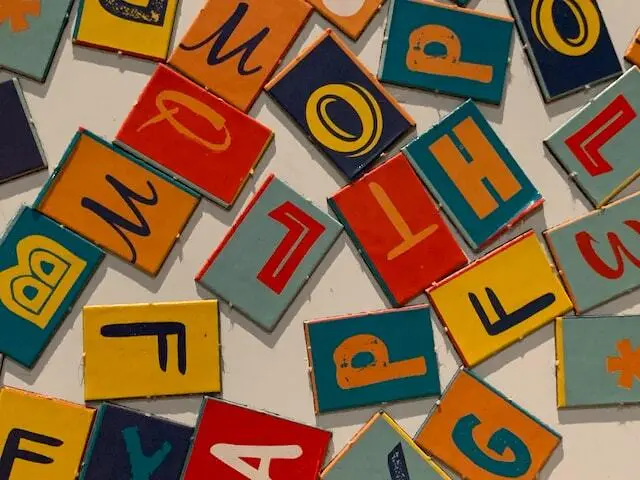
Fazit
Es gibt nicht den einen, perfekten Begriff, wenn wir über „das mit dem Klima“ sprechen. Jeder Begriff transportiert bestimmte Bilder und Wahrnehmungen. Wichtig ist, sich darüber bewusst zu sein und bewusst mit der Sprache umzugehen. In jeder Situation kann ein anderer Begriff passend sein, je nach dem, was wir gerade ausdrücken wollen, welchen Schwerpunkt wir gerade setzen wollen.
Gleichzeitig sollten wir so oft wie möglich klar benennen, in welcher Situation wir uns befinden: in einer Katastrophe, drohendem Kollaps, gesellschaftlichem Umbruch, Überleben. Werden wir deutlich und so konkret wie möglich.
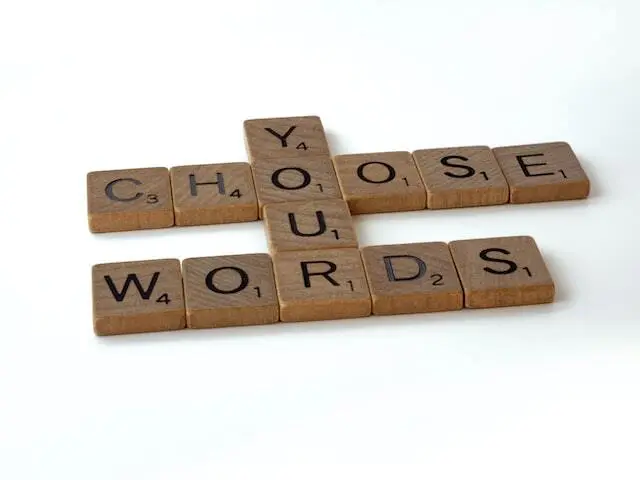
Quellenangabe (letzter Zugriff jeweils am 17.11.2022):
- Treibhauspost #36 vom 29.10.2022, „Das, dessen Name nicht genannt werden kann“, Onlineversion unter https://steadyhq.com/de/treibhauspost/posts/60f32a75-d28f-40db-a9c6-57890f147fde
- „Framing: die Macht der Sprache“ https://klimartikulieren.at/framing/
- „Welche Herausforderungen gibt es bei der Klimakommunikation?“ https://allianz-entwicklung-klima.de/toolbox/welche-herausforderungen-gibt-es-bei-der-klimakommunikation/
- „Sprache bedeutet immer Einflussnahme“ https://www.wissenschaftskommunikation.de/sprache-bedeutet-immer-einflussnahme-31495/

Eine Story von: Stephanie
Stephanie schreibt ehrenamtlich für die WWF Jugend Community. Sie ist im Redaktions- und Aktionsteam. Auch du kannst hier mitmachen – melde dich gerne bei uns.